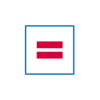In diesem Jahr jährt sich der sogenannte „Sommer der Migration“ zum zehnten Mal. In den Jahren 2015 und 2016 stellten insgesamt 1,2 Millionen Menschen in Deutschland einen Asylantrag, der größte Teil von ihnen waren Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. In der Folge entstand eine beeindruckende solidarische Bewegung aus der Zivilgesellschaft heraus, die entscheidend zur Aufnahme beitrug. Mit angepackt haben damals auch zahlreiche Paritätische Mitgliedsorganisationen.
Zehn Jahre später ist klar, wie viel erreicht und geleistet wurde – durch die Geflüchteten wie auch die Aufnahmegesellschaft. Die Ankommenden von damals sind heute ein Teil Deutschlands, sie sind Staatsbürger*innen, Familienmitglieder, Freund*innen, Nachbar*innen oder Kolleg*innen. Sie sind der Beweis dafür, was durch Engagement, Offenheit und Solidarität möglich ist. Und klar ist auch: Ohne die Erfahrungen von 2015 wäre die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine in 2022 nicht so gut gelungen.
Seit 2015 wird jedoch auch kontrovers um die Themen Flucht und Migration gerungen. Insbesondere rechtsextreme Akteure nutzen die politischen Entscheidungen von damals für Hetze gegen Geflüchtete, sie unterstützende Organisationen oder Personen, sowie die menschenrechtlichen Grundlagen des Flüchtlingsschutzes. Dabei werden Geflüchtete für reale Missstände wie fehlende soziale Sicherheit, Inflation, fehlenden Wohnraum oder eine marode Infrastruktur verantwortlich gemacht. Der Tenor: Uns ginge es besser, wenn hier keine Geflüchteten wären.
Aber das Gegenteil ist der Fall: Deutschland profitiert von Zuwanderung. Nicht nur im Sinne einer vielfältigeren Gesellschaft. Geflüchtete leisten auch einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung der anstehenden demographischen Umbrüche. Laut einer jüngsten Studie des IAB sind 64 % der 2015 nach Deutschland geflüchteten Menschen in Arbeit. Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung sind es 70 %. Seit Jahren kommen immer mehr von ihnen in Arbeit. Viele der damals Geflüchteten arbeiten in Engpass- oder systemrelevanten Berufen und halten damit die Gesellschaft am Laufen. Besonders erfolgreiche Geschichten tauchen dabei in der Statistik gar nicht mehr auf, da für sie nach einigen Jahren die Einbürgerung anstand. Das war seit 2016 z.B. für 244.000 Syrer*innen der Fall.
Darüber hinaus ist der Flüchtlingsschutz auch eine humanitäre Verpflichtung. Es wäre ein Trugschluss, zu meinen, in einer konfliktreichen Welt könnten sich liberale Demokratien schadlos vor dem Thema Flucht abschotten. Sie müssen sich dieser Aufgabe vielmehr proaktiv und gestaltend annehmen, um ihre Werte bewahren zu können: Gleiche Menschenwürde und starke individuelle Rechte für alle, ungeachtet ihrer Herkunft. Wer hiervon abkehrt, schwächt die liberale Demokratie, statt sie zu stärken.
Daher muss beim Blick auf 2015 die entscheidende Frage lauten: Was können wir aus vergangenen Fluchtbewegungen für die Zukunft lernen? Mittlerweile gibt es zahlreiche Erkenntnisse.
So sollten Aufnahmestrukturen nachhaltig auf- statt zurückgebaut werden. Kommunen gelingt die Aufnahme nachweislich besser, wenn Strukturen klug vorgehalten werden. Dazu zählen neben Aufnahmeeinrichtungen auch die Arbeit zivilgesellschaftlicher Akteure und ihre Netzwerke vor Ort, die in Kooperation mit den Behörden für die Aufnahmefähigkeit und Integration entscheidend sind.
Einen Fokus sollten auch weitere Verbesserungen bei der Arbeitsmarktintegration darstellen. Arbeitsverbote sollten konsequent abgeschafft und die Anerkennung von Qualifikationen verbessert werden. Es besteht zudem enormes Potential bei der Arbeitsmarktintegration geflüchteter Frauen. Hauptgründe: Mangelnde Kinderbetreuung und fehlende Sprachkurs-Angebote, die auf die Situation von Müttern zugeschnitten sind.
Zudem erschwert der allgemeine Mangel an bezahlbarem Wohnraum oftmals den Auszug aus Unterkünften und belastet somit die Unterbringung. Oft wird in diesem Zusammenhang von einer „Auszugskrise“ gesprochen. Darüber hinaus muss Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt effektiv begegnet werden. Hilfreich wäre auch die Aufhebung der Wohnsitzauflage, die es anerkannten Geflüchteten in der Regel drei Jahre lang untersagt, ihren Wohnort zu wechseln.
Für Ankommen und Einleben braucht es zudem Unterstützungsangebote, seien es Beratung oder psychosoziale Unterstützung. Die entsprechenden Bundesprogramme für die Asylverfahrensberatung, Migrationsberatung für Erwachsene Zugewanderte und psychosozialen Zentren sollten daher bedarfsgerecht ausgebaut und ausreichend finanziert werden.
Klar ist jedoch auch: Die Garantie des individuellen Rechts auf Asyl braucht staatliche Kooperation. Flüchtlingsschutz funktioniert nur mit einer solidarischen Verantwortungsteilung über Grenzen hinweg. Der neu eingeführte Solidaritätsmechanismus in der Europäischen Union ist hier ein erster Schritt, darf jedoch nicht dazu führen, sich von der Aufnahme Geflüchteter freizukaufen. Zu dieser Verantwortungsteilung gehört auch eine Stärkung der Strukturen in Erstaufnahmeländern - die Kürzung der Mittel für die humanitäre Hilfe im Bundeshaushalt um 50% muss insofern zwingend zurückgenommen werden.
Was also zeigt uns die Rückschau auf 2015? Vor allem die Erkenntnis, dass Flüchtlingsschutz nicht nur Verpflichtung, sondern auch Bereicherung und Chancen bedeuten, die es zu nutzen gilt. Wenn wir heute zurückschauen, sollten wir den Blick zugleich zuversichtlich nach vorne richten. Der Sommer 2015 zeigt, wie viel gemeinsam und solidarisch erreicht werden kann – und er bietet wichtige Erfahrungen, aus denen wir für eine zukunftsfeste und menschliche Aufnahme von Geflüchteten lernen können.